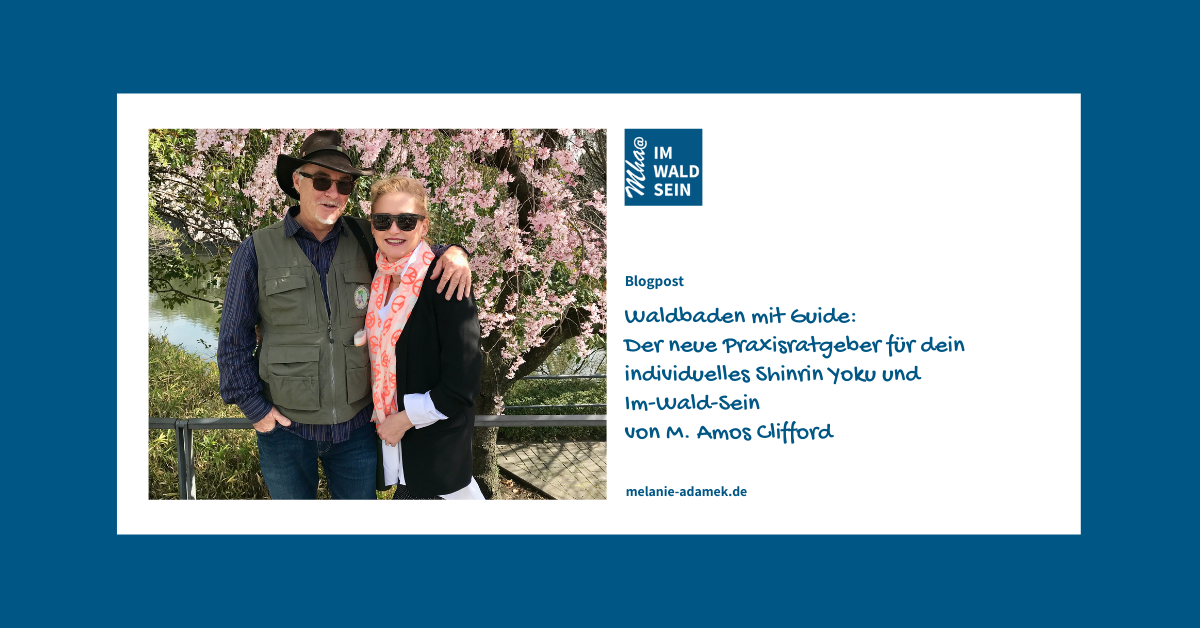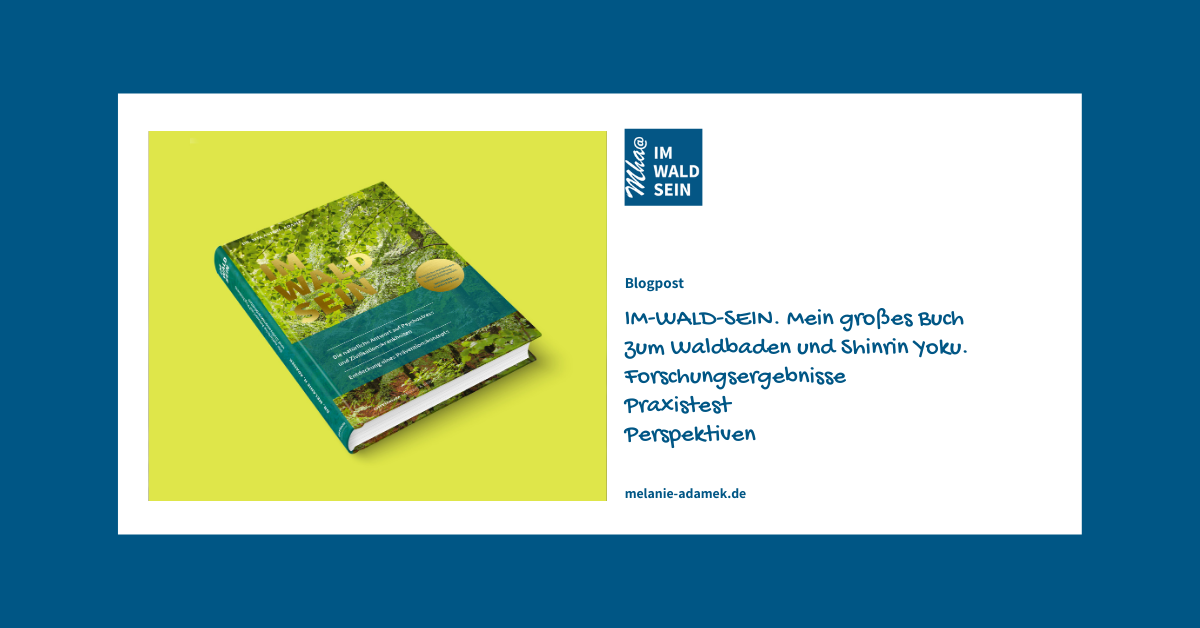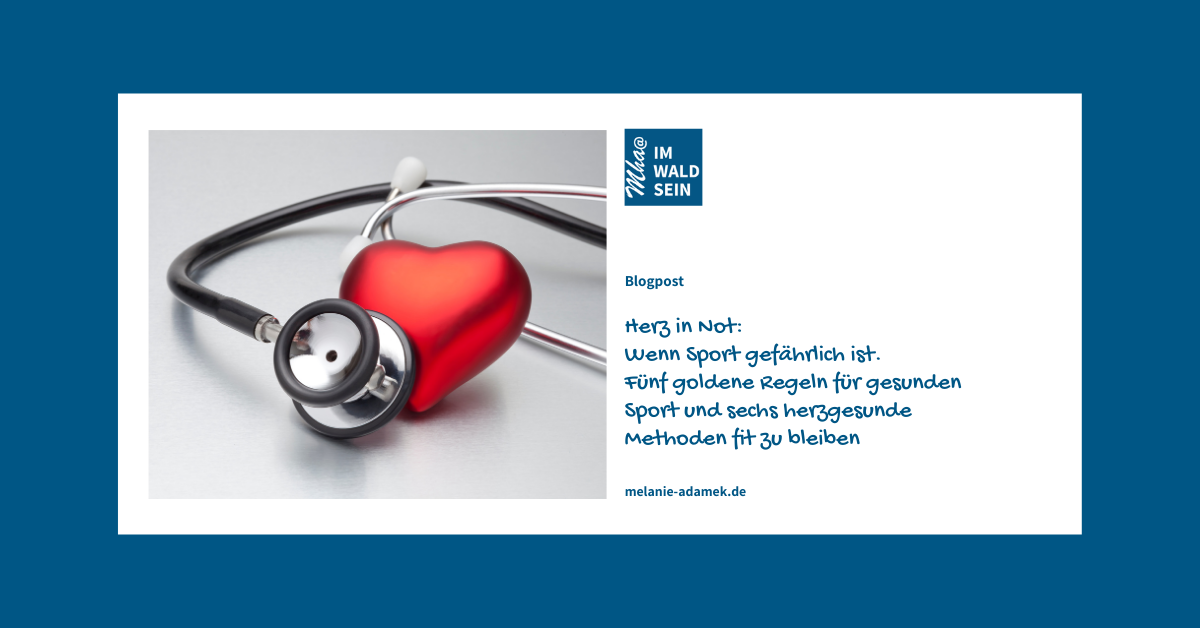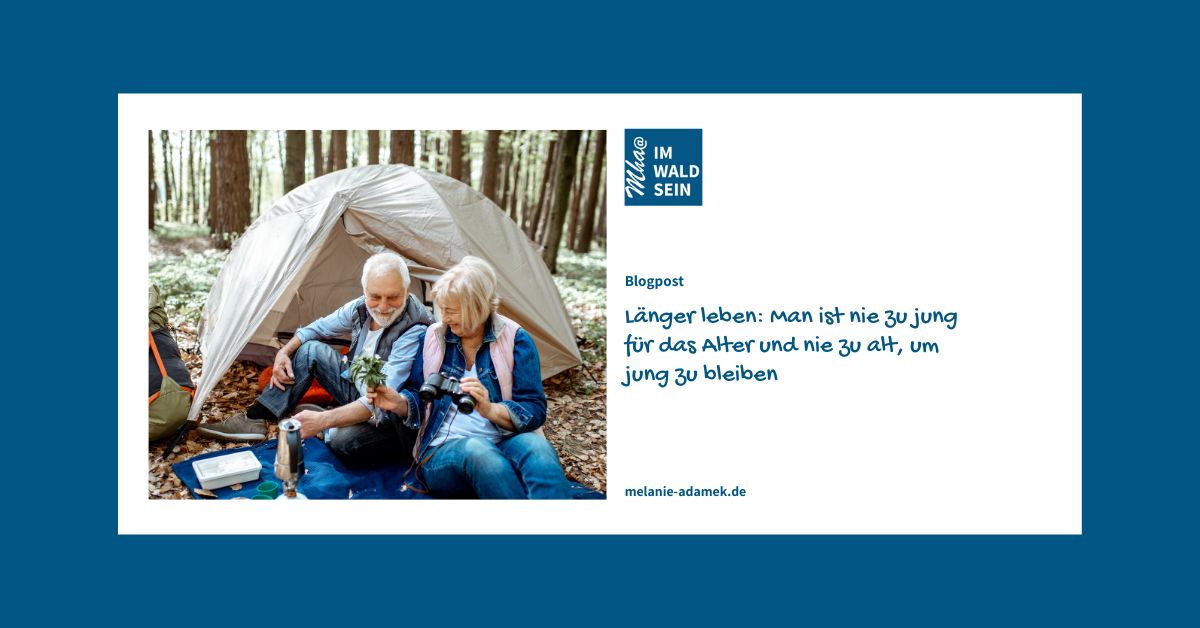Biophilie: die Liebe zur Natur. Mit Biophilic Design im Innenraum erlebbar. Praxisbeispiel und 14 Muster zur Umsetzung
Unwiderstehlich und tief verankert
„Wenn es mir nicht gut geht und ich eine Pause brauche, gehe ich in die Natur.“ So oder ähnlich hat das schon jeder von uns auf den Punkt gebracht. Egal, ob man Outdoor-Sport macht, einen Spaziergang an der frischen Luft einlegt, den Tierpark besucht, ein Picknick macht oder zum Bäume-Umarmen geht. Natur übt eine unwiderstehliche Anziehung auf uns aus. Die Liebe zur Natur ist tief in uns verankert. Wird diese Liebe nicht ausgelebt, macht uns das auf Dauer krank. Gleichzeitig erleben wir eine wachsende Verstädterung. Höchste Zeit, mehr Natur in unsere Lebensräume zu bringen.
Es liegt an der DNA
Die Biophilie-Hypothese beschreibt das Bedürfnis des Menschen, eine Verbindung mit anderen Lebensformen (Tiere und Pflanzen) und Landschaften einzugehen. Dieses Bedürfnis stammt aus einer biologisch begründeten Verbundenheit mit der Natur (Wilson, 1984; Kellert, 2005).
Auch wenn wir es uns nicht immer bewusst machen, wir haben eine eindeutige „Öko-Dimension“. Evolutionsbiologisch betrachtet ist der Mensch ein Natur-Wesen. Die internationale Studienlage zu den Auswirkungen naturfremder Lebensstile zeigt deutlich, dass die Qualität der Umwelt und somit auch die Qualität unserer Interaktionen mit dieser einen erheblichen Einfluss auf unseren Gesundheitszustand haben. Stichwort: Natur-Defizit-Syndrom (nature deficit disorder).
Biophiles Design
„Biophilic Design“ steht für eine Forschung, Theorie und Praxis, die darauf abzielt, umbaute Räume so zu gestalten, dass man den Kontakt zur Natur (wieder)herstellen kann. Es bringt die Natur in unsere Lebens-, Behandlungs- und Arbeitsräume. Dabei wird bewusst eine multisensorisch erfassbare Naturnähe geschaffen, um dem menschlichen Bedürfnis der Verbindung mit der Natur (Biophilie-Hypothese) gerecht zu werden. Biophiles Design bildet also die Grundlage, um sich unbewusst mit der Natur zu verbinden. Die heilsame Wirkung ist in vielen Studien nachgewiesen und faszinierend.
Salutogene Wirkung
Biophiles Design kann Stress reduzieren, Wohlbefinden, Denkschärfe und Kreativität steigern, fördert die soziale Interaktion und sogar die Heilung von Krankheiten beschleunigen. Da sich die Weltbevölkerung weiter verstädtert, werden diese Aspekte immer wichtiger. Forscher, Designtheoretiker und -praktiker arbeiten seit Jahrzehnten daran, Faktoren der Natur herauszuarbeiten, die unsere Zufriedenheit mit umbauten Räumen beeinflussen und steigern.
Stressreduktion
Blicken Menschen auf positiv aufgeladene Naturszenen, so reduziert das Stress. Auslöser kann der Blick aus dem Fenster auf eine gefällige Landschaft sein oder die Betrachtung einer in den Raum geholten, konstruierten Landschaft.
Gesteigertes Wohlbefinden
Tauchen wir in die Natur ein, so erleben wir eine Vielfalt arrhythmischer Reize: Vögel zwitschern, Blätter rascheln, der Geruch von Harz liegt in der Luft. Das steigert unser Wohlbefinden. Im Gegensatz dazu ist im bebauten Raum alles vorhersehbar. Gut gesetzte Reize, die überraschen, machen Räume lebenswerter.
Klarheit im Denken
Biophiles Design kann die Klarheit des Denkens fördern. Nicht immer muss dafür auf visuelle Elemente zurückgegriffen werden. Forschungen belegen, dass Naturgeräusche positiven Einfluss auf die kognitive Leistung haben können. Für die Umsetzung bieten sich schier unendliche Möglichkeiten.
Soziale Interaktion
Seit jeher trafen sich Menschen auf neutralem Boden, wo sie mit anderen Ressourcen teilten, beispielsweise an Wasser- oder Feuerstellen. Heute können dem nachempfundene Bereiche Begegnungen fördern, dem Austausch von Ressourcen und Ideen dienen und die Kommunikation steigern – selbstverständlich unter Einhaltung aller bau- und brandschutzrechtlichen Bestimmungen.
Kreatives Handeln
Eine Serie von Experimenten belegte, dass Probanden, die vor Durchführung einer Aufgabe die Farbe Grün betrachteten, eine bessere Kreativitätsleistung zeigten.
Schnellere Genesung
Sehr viele Forschungsarbeiten beschäftigen damit, inwieweit sich Menschen nach Operationen besser und schneller erholen, wenn die Natur in den Heilungsprozess miteinbezogen wird. Der schwedische Gesundheitsdesignforscher Prof. Dr. Roger Ulrich lieferte bereits 1984 den noch heute aufsehenerregenden, weltweit anerkannten Beweis, dass allein schon der Anblick von Bäumen zu besseren Gesundungsverläufen führt.
Für seine im Fachmagazin Science veröffentlichte Studie wurden 46 Patienten in einem standardisierten Verfahren an der Gallenblase operiert, gleichwertig versorgt und untergebracht. Mit einem entscheidenden Unterschied: Ein Teil der Patienten blickte aus dem Fenster auf einen Baum.
Prof. Dr. Ulrich konnte nachweisen: Die Patienten der „Baumgruppe“ wurden schneller gesund, sie hatten weniger postoperative Komplikationen, eine bessere Wundheilung, benötigten weniger sowie schwächere Schmerzmittel und litten seltener unter Depressionen. Die Ergebnisse dieser Studie wurden seither immer wieder bestätigt.
Biophiles Design am Arbeitplatz
Die positiven Effekte des biophilic Design am Arbeitsplatz gehen aus dem „Human Spaces Report“ von 2015 hervor. Sir Cary Cooper, Professor für Organisationspsychologie an der Lancaster University in Großbritannien befragte 7.600 Angestellte aus 16 Ländern. Arbeitnehmer, deren Arbeitsumfeld von Elementen wie Sonnenlicht und Grünpflanzen geprägt war, berichteten von gesteigertem Wohlbefinden (15%), mehr Produktivität (6%) und höherer Kreativität (15%).
Praxisbeispiel: Biophiles Design am Arbeitsplatz
Ein gelungenes Beispiel für eine biophile Raumgestaltung am Arbeitsplatz bieten die
IM-WALD-SEIN® City Offices. Biophilic Coworking. In diesem Co-Working Space im Herzen von München haben die Designexperten des
IM-WALD-SEIN® INSTITUTS FÜR WALDMEDIZIN UND WALDTHERAPIE das Konzept einer entspannten, naturverbundenen Arbeitsatmosphäre geschaffen.
Im Büro „Kronendach“ arbeitet man unter dem Kronendach des Waldes. Auch Meetings, Workshops oder Konferenzen sind möglich. Das Office „Kraftquelle“ spielt mit Elementen des Wassers und einer Flusslandschaft. Die Räume sind ergonomisch und nach den unten genannten Grundsätzen so gestaltet, dass man sich sensorisch mit der Natur verbinden kann. Zwischendurch macht man sich einen Tee in der „ForRest“-Küche, trifft sich unter dem „Ideenbaum“, tratscht auf dem Balkon zum grünen Hinterhof, wo der Lavendel einen beruhigenden Duft verströmt. Besonders spannend ist die Umsetzung des Patterns 12: Eine Waldkapsel dient als Rückzugsort und lädt zum Entspannen ein.
Mehr hier
„14 Paterns“ des biophilen Designs
Die Experten von Terrapin Bright Green haben „14 Patterns of Biophilic Design“ definiert. Die Muster dienen als Gestaltungsprinzipien, um die Beziehungen zwischen Natur, menschlicher Biologie und dem Design umbauter Räume erlebbar zu machen. Sie stützen sich auf neurowissenschaftliche und psychologische Erkenntnisse.
- Visuelle Verbindung mit der Natur. Freier Blick auf Elemente der Natur, lebende Systeme und natürliche Prozesse.
- Nicht-visuelle Verbindung mit der Natur. Auditive, haptische, olfaktorische oder gustatorische Reize, die einen bewussten und positiven Bezug zur Natur, zu lebenden Systemen oder natürlichen Prozessen herstellen.
- Nicht-rhythmische sensorische Reize. Stochastische und flüchtige Verbindungen zur Natur, die zwar statistisch analysiert, aber nicht genau vorhergesagt werden können.
- Thermische und Luftstrom-Variabilität. Subtile Veränderungen der Lufttemperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit, des Luftstroms über der Haut und der Oberflächentemperaturen, die die natürliche Umgebung nachahmen.
- Vorhandensein von Wasser. Ein Zustand, der die Erfahrung eines Ortes durch das Sehen, Hören oder Berühren von Wasser verbessert.
- Dynamisches und diffuses Licht. Unterschiedliche Licht- und Schattenintensitäten, die sich mit der Zeit verändern, um Bedingungen zu schaffen, die in der Natur vorkommen.
- Verbindung mit natürlichen Systemen. Bewusstsein für natürliche Prozesse, insbesondere für saisonale und zeitliche Veränderungen, die für ein gesundes Ökosystem charakteristisch sind.
- Biomorphe Formen und Muster. Symbolische Hinweise auf konturierte, gemusterte, strukturierte oder numerische Anordnungen, die in der Natur bestehen.
- Materielle Verbindung mit der Natur. Materialien und Elemente aus der Natur, die durch minimale Bearbeitung die örtliche Ökologie oder Geologie widerspiegeln und ein ausgeprägtes Ortsgefühl schaffen.
- Komplexität und Ordnung. Reichhaltige sensorische Informationen, die sich an eine räumliche Hierarchie halten, die denen in der Natur ähnelt.
- Aussicht. Eine ungehinderte Fernsicht, die der Übersicht und Planbarkeit dient.
- Rückzugsort. Ein Ort, an dem man sich von den Umgebungsbedingungen oder dem Hauptstrom der Aktivitäten zurückziehen kann und an dem der Einzelne von hinten und von oben her geschützt ist.
- Geheimnis. Das Versprechen auf mehr Information, das durch teilweise verdeckte Blicke oder andere sensorische Hilfsmittel erreicht wird, die das Individuum dazu verlocken, tiefer in die Umgebung einzudringen.
- Risiko/Gefahr.
Eine identifizierbare Bedrohung in Verbindung mit einem zuverlässigen Schutz.